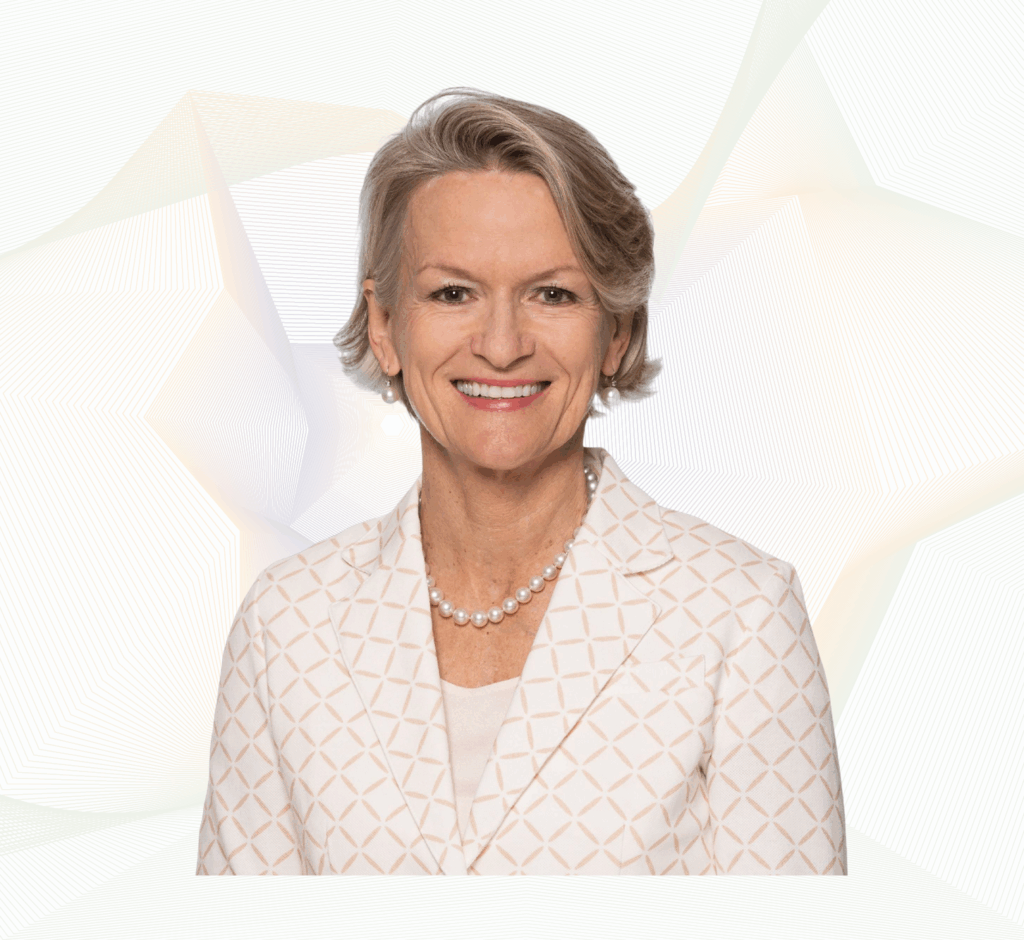Andrea Gmür-Schönenberger, Ständerätin und Mitglied des SSREI-Advisory Boards im exklusiven Interview zum Thema «nachhaltige Klimapolitik, bezahlbarer Wohnraum und zukunftsfähige Rahmenbedingungen für den Immobiliensektor».
Wohnungsknappheit, bezahlbarer Wohnraum – das sind die aktuellen Lieblingsthemen der Medien, wenn es um Immobilien geht. Wie steht es mit dem Klima? Ist dieses Problem gelöst oder nicht mehr in Mode?
Nein, das Klimathema ist im Gebäudebereich nicht gelöst, aber wir sprechen heute anders darüber.
Wir haben mit der Energiestrategie 2050 und dem Klima- und Innovationsgesetz wichtige Grundlagen geschaffen. Doch in der Praxis stehen wir weiterhin vor drei grossen Herausforderungen:
Erstens: Wir müssen den Ausstieg aus fossilen Heizsystemen weiter vorantreiben – und gleichzeitig die Versorgungssicherheit im Winter gewährleisten.
Zweitens: Der Gebäudebestand braucht mehr Effizienz, nicht nur durch Technik, sondern durch einen guten Betrieb und intelligente Lösungen vor Ort.
Drittens: Klima und Wohnraum dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir müssen beides gleichzeitig denken: genug bezahlbarer Wohnraum und klimataugliche Gebäude.
Für mich ist klar, dass das Thema nicht aus der Mode ist – es ist breiter geworden. Und wir müssen es so angehen, dass Bevölkerung, Umwelt und Wirtschaft davon profitieren.
Mit einer Lüftung inklusive Wärmerückgewinnung, Einstellung der Vorlauftemperatur auf eine moderate Raumtemperatur, betriebliche Kontrolle und Optimierung könnte man die Thematik enorm entschärfen. Müsste die Gesetzgebung nicht auch hier ansetzen?
Sie sprechen einen Punkt an, der oft unterschätzt wird: Mit einem gut eingestellten und gewarteten System kann man sehr viel erreichen, ohne grosse bauliche Eingriffe. Ich bin aber zurückhaltend, wenn es darum geht, all diese betrieblichen Details im Gesetz zu regeln. Die Aufgabe der Politik ist es, klare Rahmenbedingungen und Anreize zu setzen. Die konkrete Umsetzung gehört jedoch in die Hände von Fachleuten, Eigentümerinnen und Eigentümern.
Wenn wir die Energieeffizienz im Betrieb stärken wollen, dann eher über gezielte Förderprogramme, Beratungsangebote und Mindestanforderungen bei grösseren Anlagen, nicht über jede einzelne Vorlauftemperatur im Gesetzestext.
Die Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen zur Verminderung von Treibhausgasemissionen oder zur CO2-Entnahme und -Speicherung ist im Klima- und Innovationsgesetz KIG verankert. Nun werden aber wegen des Sparpakets des Bundesrates bereits keine Finanzbeiträge für P+D-Projekte (Pilot- und Demonstrationsprogramm) mehr gewährt. Wird da am richtigen Ort gespart?
Wir alle wissen, dass der Bundeshaushalt unter Druck steht. Sparen ist also nötig – aber gerade bei Pilot- und Demonstrationsprojekten müssen wir sehr genau hinschauen. Diese Programme helfen, neue Technologien aus der Forschung in die Praxis zu bringen, und sind damit zentral für unsere Klima- und Innovationspolitik.
Aus meiner Sicht darf es keine Kürzungen mit der Giesskanne geben. Ich setze mich dafür ein, dass wir im Parlament sorgfältig priorisieren: Mittel dort reduzieren, wo sie wenig Wirkung haben, und gezielt dort erhalten, wo Innovation und Klimaschutz am meisten profitieren.
Mit dem KIG wurde auch die finanzielle Förderung des Ersatzes von Öl-, Gas- und Elektroheizungen durch klimafreundliche, erneuerbare Systeme gesetzlich verankert. Auch diese geriet nun in die Bredouille des Sparpakets. Dies macht doch den Anschein, dass der Bundesrat die Zeichen der Zeit nicht erkennt.
Der Ersatz fossiler Heizungen ist für unsere Klimaziele zentral, und die bisherigen Förderprogramme haben diese Entwicklung klar beschleunigt. Gleichzeitig müssen wir verantwortungsvoll mit den öffentlichen Mitteln umgehen.
Für mich ist entscheidend, dass wir jetzt nüchtern prüfen: Wo ist eine Förderung weiterhin nötig, damit auch Haushalte mit komplexen oder teuren Ausgangslagen den Wechsel schaffen? Und wo hat der Markt inzwischen genügend Dynamik, um ohne staatliche Unterstützung auszukommen?
Ich möchte deshalb keine pauschalen Kürzungen, sondern eine gezielte Priorisierung. Der Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme muss für die Bevölkerung planbar und bezahlbar bleiben und gleichzeitig müssen wir die Bundesfinanzen im Blick behalten.
Kommen wir zurück zur sozialen Nachhaltigkeit. Auch dort tut sich in der Gesetzeslandschaft einiges. So haben Genf und jüngst auch Basel Wohnschutzgesetze eingeführt. Werden andere Kantone nachziehen?
Wir sehen in mehreren Städten, dass der Druck auf bezahlbaren Wohnraum stark zunimmt. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass Kantone wie Genf und Basel mit Wohnschutzgesetzen reagiert haben – und ja, ich gehe davon aus, dass ähnliche Diskussionen auch in anderen Kantonen geführt werden, so z.B. auch in meinem Heimatkanton Luzern.
Mir ist wichtig, dass wir hier die Balance wahren: Mieterinnen und Mieter brauchen Schutz vor Verdrängung, gleichzeitig müssen Investitionen in den Wohnungsbau aber weiterhin attraktiv bleiben, nicht zuletzt, weil Pensionskassen und Sammelstiftungen mit Immobilien unsere Altersvorsorge sichern.
Ich setze deshalb stark auf Dialog und Eigenverantwortung der Branche: Wo sie Lösungen anbietet – etwa mit moderaten Mieten, angepassten Wohnungsgrössen oder neuen Wohnformen –, kann sie – im eigenen Interesse – dazu beitragen, übertriebene Eingriffe des Gesetzgebers zu vermeiden.
Erlauben Sie mir die Bemerkung, dass die überwiegende Mehrheit der Mieten aktuell Bestandsmieten sind und auch unter diesen Voraussetzungen in der Branche Geld verdient wird.
Das stimmt, viele Menschen leben in Bestandsmietverhältnissen, und diese Mieten sind in der Regel deutlich tiefer als die Preise von neu vermieteten Wohnungen. Gleichzeitig dürfen wir die Realität der letzten Jahre nicht ausblenden: Bodenpreise, Baukosten und auch regulatorische Anforderungen sind stark gestiegen.
Diese Entwicklungen widerspiegeln sich zwangsläufig in den Mietpreisen neuer Wohnungen. Entscheidend ist für mich, dass wir bei allen Diskussionen die Ursachen offen ansprechen und nicht mit einfachen Schuldzuweisungen arbeiten. Wenn wir mehr bezahlbaren Wohnraum wollen, müssen wir Planung, Bauprozesse und Kosten insgesamt im Blick behalten und nicht nur die Mieterseite oder die Eigentümerschaft.
Sind nationale Wohnschutzgesetze denkbar?
Ja, nationale Wohnschutzgesetze sind denkbar, denn die Bundesverfassung verpflichtet Bund und Kantone ausdrücklich dazu, dafür zu sorgen, dass Menschen Zugang zu angemessenem und bezahlbarem Wohnraum haben. Ob wir diesen Weg gehen müssen, hängt aber stark davon ab, wie sich die Situation in den Kantonen entwickelt.
Ich sehe es so: Je besser es gelingt, dass Gemeinden, Kantone und die Branche gemeinsam Lösungen finden, desto weniger braucht es eine nationale Regulierung. Der grösste Hebel liegt beim Bauen selbst – und dort bremsen heute häufig langwierige Verfahren und Einsprachen.
Genau deshalb habe ich mich bereits 2023 mit meinem Postulat für «Massvolle Kostenauflagen bei Einsprachen in Baubewilligungs- und Nutzungsplanverfahren» eingesetzt und kürzlich haben Bundesrat und Ständerat meine beiden Motionen «Baueinsprachen. Schutzwürdige Interessen klar definieren» und «Missbräuchliche Baueinsprachen sanktionieren» angenommen. Es geht nicht darum, Rechte einzuschränken, sondern missbräuchliche Verzögerungen zu verhindern. Wenn wir die Kapazitäten schneller ausbauen können, entschärfen wir die Wohnraumsituation und reduzieren den Druck auf neue nationale Eingriffe.
Effektiv zeigt die Studie von Sotomo, dass mit den bestehenden Bauzonen, ohne neue Flächen zu nutzen, in der Schweiz ein Potenzial für Wohnraum für zusätzlich zwei Millionen Menschen besteht.
Die Studie zeigt sehr deutlich, dass wir beim bestehenden Boden ein enormes Potenzial haben. Genau dort müssen wir ansetzen. Bevor wir über neue Einzonungen diskutieren, sollten wir sicherstellen, dass wir die bereits vorhandenen Möglichkeiten auch wirklich nutzen.
Deshalb ist es wichtig, dass Projekte nicht jahrelang blockiert werden und dass Verdichtungen mit guter Qualität möglich sind. In vielen Fällen scheitert Wohnraum nicht am fehlenden Land, sondern an langwierigen Verfahren oder an Nutzungskonflikten.
Wenn wir diese Hürden reduzieren und gleichzeitig Rückzonungen dort vornehmen, wo Land offensichtlich am falschen Ort eingezont wurde, schaffen wir mehr Klarheit und bringen den Wohnungsbau insgesamt schneller voran.
Der durchschnittliche Flächenbedarf fürs Wohnen liegt mit 46m2 weit über dem europäischen Durchschnitt. Müsste man hier ansetzen?
Der hohe Flächenverbrauch ist tatsächlich ein Thema, aber er ist nicht einfach, über politische Vorgaben zu steuern. Viele Menschen leben heute allein, viele ältere Menschen wären bereit zu reduzieren, finden aber keine kleinere Wohnung zu günstigeren Konditionen. Wiederum wünschen sich andere mehr Platz. Das ist Ausdruck unseres Wohlstandes und unserer Lebensformen.
Die Aufgabe lautet also, dass wir das Angebot besser an die tatsächliche Nachfrage anpassen. In vielen Regionen fehlen kleinere, bezahlbare Wohnungen – und genau diese würden die Nutzungsdichte verbessern, ohne die Leute zu bevormunden.
Wenn wir den Wohnungsmarkt entlasten wollen, erreichen wir mehr mit einer guten Mischung an Wohnungsgrössen und durch verdichtetes Bauen mit Qualität als mit Eingriffen in die individuelle Wohnfläche.
Diese Single-Haushalte haben auch mit unserer demografischen Entwicklung, sprich Überalterung, zu tun. Die Kinder ziehen aus, der Partner stirbt und die zurückbleibende Person wohnt dann noch jahrelang allein in der mittlerweile viel zu grossen Wohnung. Gibt es da ein politisches Mittel?
Es ist grundsätzlich eine gute Entwicklung, dass ältere Menschen heute lange in den eigenen vier Wänden bleiben können; das entspricht ihrem Wunsch und entlastet auch die öffentlichen Budgets.
Gleichzeitig sehen wir einen klaren Mangel an altersgerechten Wohnungen, gerade in gewohnten Quartieren. Politisch können wir hier vor allem Rahmenbedingungen und Anreize schaffen, etwa durch die Förderung von altersgerechten Umbauten, neuen Wohnformen und Projekten, die den Umzug in eine passende Wohnung ermöglichen, ohne dass die Betroffenen ihr Quartier oder ihr soziales Umfeld verlieren. Wir sollten niemanden drängen, aber es den Menschen leichter machen, dann umzuziehen, wenn es für sie selbst sinnvoll wird.
Liberale Kreise sagen, man müsse nur das Mietrecht ändern und den Schutz der Bestandsmieten aufheben, dann komme sofort Dynamik ins Umzugsverhalten. Stimmen Sie dem zu?
Ich halte wenig von der Vorstellung, man müsse nur den Schutz der Bestandsmieten abbauen und schon löse sich das Problem von selbst. Wohnen ist ein sehr sensibler Bereich – zu viel Unruhe beim Mietrecht hätte schnell soziale Spannungen zur Folge.
Natürlich braucht der Wohnungsmarkt eine gewisse Dynamik. Aber diese erreichen wir eher über mehr passenden Wohnraum, schnellere Verfahren und gute Anreize als über die radikale Schwächung des Mieterschutzes. Stabilität und Planbarkeit für die Menschen sind mir hier genauso wichtig wie Investitionssicherheit für die Eigentümerschaft.
Andere geben die Schuld der komplizierten Gesetzgebung und den langwierigen Baubewilligungsverfahren. Müsste man hier für eine Entschlackung sorgen?
Ich höre diese Kritik oft und ja, die Verfahren sind teilweise zu lang und zu schwerfällig. Das kostet Zeit, Geld und Nerven und hilft weder den Mietenden noch der Bauherrschaft.
Gleichzeitig hat die Komplexität auch Gründe, die wir als Gesellschaft so vorgegeben haben: Wir müssen Interessen von Nachbarn, Umwelt, Sicherheit und Ortsbild sorgfältig abwägen. Mein Ziel ist deshalb nicht ein Abbau des Schutzes, sondern mehr Klarheit und Effizienz: klare Zuständigkeiten, schlanke Prozesse, digitale Abläufe.
Wenn wir es schaffen, schneller und transparenter zu entscheiden, Zielkonflikte mutig zu benennen und den Entscheid für und gegen ein Ziel zu begründen, schaffen wir mehr Wohnraum, ohne die Qualität und den Rechtsstaat zu opfern.
Das Problem des bezahlbaren Wohnraums ist also lösbar, wenn alle Akteure mithelfen?
So ist es. Für komplexe Probleme gibt es keine einfachen, linearen Lösungen. Alle Anspruchsgruppen müssen ihre Rolle und Verantwortung kennen und wahrnehmen: Die Mieterschaft, welche eine gewisse Mietzinserhöhung wohl in Kauf nehmen muss; die Immobilienbranche, welche situativ und in vertretbarem Masse auf Rendite verzichten muss; Behörden, welche ihre Verfahren effizienter gestalten müssen; Bürgerinnen und Bürger, welche wieder im Sinne der Gesellschaft denken und nicht egoistisch den eigenen Interessen den Vorzug geben.
Wenn dieser Wille zur Zusammenarbeit fehlt und sich alle nur auf ihren eigenen Vorteil fokussieren, wächst der Druck auf die Politik – und dann werden die Antworten automatisch regulativer und härter.
Bevor Gesetze kommen, gibt es noch die Möglichkeit, sich an Standards zu halten. Das sind privatrechtliche Vereinbarungen. Diesen müsste die Branche den Vorzug geben, oder?
Standards sind eine grosse Chance für die Branche. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich für den SSREI engagiere. Wichtig ist, dass sich hier nun der Markt konsolidiert, dass er sich nämlich auf ein paar wenige Standards einigt. Mit unzähligen verschiedenen Standards können wir den Schweizer Gebäudepark nicht in eine einheitliche, nachhaltige Richtung entwickeln. Und das ist ja das ultimative Ziel.
Welcher Standard wird das Rennen machen?
Das soll und kann die Politik nicht entscheiden, denn das ist Aufgabe der Branche.
Aus meiner Sicht werden sich jene Standards durchsetzen, die zwei Dinge leisten: Sie müssen einerseits die aktuellen Herausforderungen klar benennen – Klima, Energie, soziale Fragen, Qualität – und andererseits praxistaugliche Lösungen anbieten, die sich im Alltag von Eigentümern, Investoren und Planern bewähren.
Am Ende wird nicht der lauteste oder einfachste Standard gewinnen, sondern jener, dem Markt und Fachwelt vertrauen und der Mehrwert statt nur mehr Bürokratie bringt.
Nämlich?
All die Themen, die wir oben angesprochen haben, sowie Klimaresilienz, Biodiversität, Mobilität und weitere, wozu unbedingt auch städtebauliche und architektonische Qualität gehören. Letztlich bieten Gebäude der Bevölkerung nicht nur Raum zum Wohnen und Arbeiten, sondern prägen auch unsere Kultur. Ich finde, wir brauchen keine staatliche Vorgabe, welcher Standard «der richtige» ist. In der Schweiz haben sich mit Minergie und SNBS auf Gebäudeebene und mit Instrumenten wie SSREI oder internationalen Benchmarks wie GRESB auf Portfolioebene gewisse Referenzen herausgebildet – das ist sinnvoll, weil es Orientierung gibt und den Aufwand begrenzt.
Genauso wichtig ist mir aber, dass der Markt offen bleibt: Wer international investiert, wird auch weiterhin mit Labels wie LEED oder DGNB arbeiten. Entscheidend ist nicht, wie das Label heisst, sondern ob es Transparenz schafft und wirklich hilft, Gebäude und Portfolios nachhaltiger zu machen.